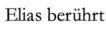Die Geschichte der Sexualität verweist auf eine paradoxe Terminologie. Wer diese verstehen will, muss nicht nur aufmerksam und intuitiv zwischen den Zeilen lesen können. Jemand, der nach einer Erkenntnis auf dem weiten Feld der Sexualität strebt, muss sich ganz der Ambivalenz der Sprache stellen, sich diese aneignen und im Bewusstsein dieser Ambivalenz langsam, äusserst vorsichtig, jedoch beharrlich in der Untersuchung vorankommen. Denn: Die lange, komplexe und widersprüchliche Geschichte der Sexualität entfaltet sich vor dem Hintergrund von Tabus. Sie ist durchdrungen von Verboten, Dogmen, Konditionierungen, Regeln, Normen und Gesetzen, denen die Sexualität selbst sich permanent entzieht. Nichts ist für die Beschreibungen der Sexualität charakteristischer als ihre Doppelgesichtigkeit und die sich daraus ergebende Doppelmoral.
Nichts wird eigennütziger interpretiert, kaum etwas wird mit mehr Angst und Selbstsucht beladen. Heuchelei und Scheinheiligkeit der Menschen sind ständige Begleiter dieser Geschichte. Ihnen folgen schweigend Religion, Kirche, Politkorrektheit und Diskretion. Sie drohen mit der Todesstrafe jedem, der sie, die Sexualität, zu entlarven versucht. Nichtsdestotrotz wird sie permanent einem Verhör unterzogen, bei dem sie über ihre eigenständige Wirklichkeit ausgefragt wird. Die Menschen sind verpflichtet, sich verpflichtet zu fühlen zu beichten, um über ihre Sexualität die ganze Wahrheit offen zu legen. Eine Ausnahme bildet die unsichtbare Hand der Macht. Sie ist dazu prädestiniert zu überwachen, zu disziplinieren und zu bestrafen, jedoch um jeden Preis ihre eigene Wahrheit über die Sexualität geheim zu halten. Die beste Metapher für die Sexualmoral ist des Kaisers neues Kleid. Der nackte Kaiser gilt als ihr unsterbliches Sinnbild. Schwerlich konnte jemand über sie klarer, transparenter und einfacher berichten als Hans Christian Andersen es in seinem Kindermärchen für kluge Erwachsene getan hat – Des Kaisers neue Kleid.
Die Sexualität sucht seit Jahrhunderten nach absoluter Befreiung, wobei ihre gezielte Unterdrückung durch die unsichtbare Macht mindestens als umstritten gilt. Sie wird durchströmt von ethischen und moralischen Diskursen, die man zum grossen Bedauern immer wieder verwechselt. Überhaupt wird sie ständig mit dem Moralischen überladen, wobei eine echte Sexualethik meistens fehlt – und das, obwohl die Sexualität mit der Moral nichts zu tun hat und zugleich eine zutiefst ethische Angelegenheit ist. Die Geschichte der Sexualität kann als Geschichte von Vorurteilen und Irrtümern erzählt werden, deren Tragödie gerade darin besteht, dass die wenigen weisen Stimmen, die im Lauf der Zeit nur ganz selten laut werden, von der Mehrheit entweder nicht gehört oder missverstanden werden. Die Geschichte der Sexualität wird immer wieder als Kampf der Kultur(en) mit der Natur präsentiert, obwohl Sexualität eine völlig natürliche Sache ist, die es ohne Kultur nie geben könnte. Und das ganz abgesehen vom echten, innigsten menschlichen Streben, diese traurige Geschichte mehr als eine Geschichte der Liebe denn als eine des Kampfes zu gestalten.
Es gibt also gute Gründe die Kulturgeschichte der Sexualität als moralisierte Tabugeschichte aufzufassen. Die extreme Doppeldeutigkeit, die im Tabubegriff innewohnt („Tabu“ bedeutet zugleich „heilig“ und „unrein“) ist für das Phänomen der Sexualität ebenfalls eigentümlich und habituell. Das Tabu beschreibt den Sex. Die nackte, weit bekannte, fast schon banale Tatsache, dass unsere Geschlechtsorgane sowohl für das Erlangen grösstmöglicher Lust wie auch für Entleerungen gebraucht werden, spiegelt das Konzept der Ambivalenz der Sexualität nicht weniger deutlich als die Auffassung der Frau im Bewusstsein der meisten Männer als Hure und Heilige zugleich. Dass durch die Vereinigung von Mann und Frau neues Leben entstehen kann, macht die ganze Sache keinesfalls einfacher. Im Gegenteil: Die plötzliche Erscheinung einer dritten Person durch den Akt, der zugleich als heilig und als unrein gilt, macht alles noch viel paradoxer als es ohnehin schon ist.
Man muss also die Vorsicht, die Ordnung, die Konsequenz, aber auch die Sinnlichkeit, die ausgeprägte Intuition, die menschliche Reife und nicht zuletzt ein hohes Einfühlungsvermögen mitbringen, um auf dem Gebiet der Sexualität und der Ethik, um auf dem wackeligen Boden von Tabus und Moral forschen zu können, handelt es sich doch dabei um die ursprünglichsten, ewigen Fragen der menschlichen Natur und der Kultur. Gleichzeitig genügen etwas Nachdenken, Abstraktionsvermögen und Sensibilität für den Topos der Sexualität, um grosse und schreckliche sexuelle Tabus wie etwa Inzest, Analverkehr, Exhibitionismus bloss als sprachliche Konstrukte zu entlarven. Die Einsicht in die Genese dieses Tabus bedarf einerseits eines ausgeprägten Intellekts in Verbindung mit einer grossen emotionalen Intelligenz, ist aber anderseits völlig selbstverständlich. Die angeborene Unschuld, Verspieltheit und Spontanität eines Kindes reichen aus, um das Wesen moralischer Tabus zu verstehen, das in Worte besteht. Genau dieser Entlarvung von Sextabus als Sprachkonstruktionen, die, wie tragisch es auch ist, seit jeher die Kulturgeschichte der Sexualität bestimmen, möchte ich meine Arbeit widmen.
Was an dieser Stelle noch zu erwähnen ist, ist der Hinweis auf den Unterschied zwischen Ethik und Moral, denn dieser Text wurde in einer bewusst amoralischen, jedoch möglichst strengen ethischen Geisteshaltung verfasst. Dabei ist es wichtig festzuhalten, dass die amoralischen Aussagen und Handlungen, im Gegensatz zu den unethischen, niemandem wirklich schaden. Das amoralische Verhalten kennt keine Opfer. Doch nirgendwo ist die Kluft zwischen Moral und Ethik so riesig, wie auf dem Gebiet der Sexualität. Gerade deshalb ist es auf diesem Gebiet so wichtig, zwischen der Moral und der Ethik nüchtern, streng und klar zu differenzieren. Onanie, Oral- und Analsex, Gruppensex, Promiskuität, – die Liste von einvernehmlichen Sexualpraktiken lässt sich unendlich fortsetzen – alles Praktiken, die als amoralisch gelten und zugleich ethisch absolut zulässig sind, da ihre Ausübung niemandem schadet.
Aus diesem Anlass zitiere ich hier den Philosophen und Schriftsteller sowie Vorstandssprecher der Giordano-Bruno-Stiftung Michael Schmidt-Salomon:
„Gerade dadurch, dass wir uns vom traditionellen Gut- und- Böse-Moralismus befreien, schaffen wir die Voraussetzungen, um ethisch in angemessener Weise handeln zu können. Denn Moralismus ist nicht die Grundlage der Ethik, er verhindert viel eher, dass wir uns ihren Anforderungen stellen.“
Elias Kirsche © Berlin/Zürich 2012